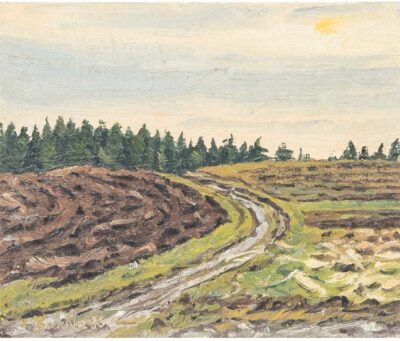Schwärmerei in Gelb
Geliebt, bewundert und beraubt: Eine große Ausstellung im Museum Wiesbaden macht die Biene zur Protagonistin der Kunstgeschichte von der Antike bis heute
Von
07.05.2025
/
Erschienen in
Weltkunst Nr. 241
Nicht einmal die Bienen wollen bei Napoleon bleiben, als der ins Exil gehen muss. 1804 hatte er sich für seine Krönung in Notre-Dame das kleine, wehrhafte Tier als Emblem ausgesucht und in Gold auf den Samt seines Ornats sticken lassen. Zehn Jahre später zwingt man ihn zur Abdankung – und auf der Radierung eines unbekannten englischen Karikaturisten sieht man, wie ihm auf dem Weg in die Verbannung der Krönungsmantel von den Schultern fällt, während die Bienen in alle Richtungen davonfliegen.
Es verabschiedet sich damit nicht bloß ein persönliches Symbol. Die Biene war Napoleons symbolhafte Verbindung in die Vergangenheit, mit ihrem Abbild auf Mantel, Tapeten und sogar der Wiege seines 1811 geborenen Sohns hatte er sich in der Herrschertradition verankern wollen: Angeblich waren schon beim ersten König der Merowinger Grabbeigaben in Bienengestalt gefunden worden. Die Mensch-Tier-Beziehung, die bis in das 5. Jahrhundert und weit dahinter zurückreicht, macht jetzt die aktuelle Ausstellung „Honiggelb“ im Museum Wiesbaden sichtbar.

Sie folgt der „Biene in der Kunst von der Renaissance bis in die Gegenwart“ und vermittelt anhand ihrer Exponate verblüffende Einsichten. Das Insekt begleitet uns seit der Antike, schon Aristoteles und Vergil schrieben über seine Eigenschaften. Auf Bildern taucht es gemeinsam mit Göttern und Nymphen auf, ebenso in religiösen Darstellungen oder spöttelnden Karikaturen wie jener über Napoleon. Honig fließt im Paradies, als Honigspender wird die Biene gehegt und gejagt, sie selbst bestraft mit ihrem Stachel gierige Diebe, zu denen Amor zählt, der auf einem Gemälde von Lucas Cranach dem Älteren eine triefende Wabe klaut. Je nach künstlerischer Absicht und Perspektive wechselt das Tier seine Rollen, was Museumsdirektor und Kurator Andreas Henning besonders für die Biene einnimmt. Der Fuchs, so sagt er, stehe immer für Schlauheit, der Löwe verkörpere in der Kunstgeschichte stets Stärke. Bloß die Biene, die auch auf dem Dach des Wiesbadener Museums lebt und hier von einem Imker betreut wird, kann alles sein: vom Soldaten bis zur Königin wie auf der anonymen Radierung „The Queen Bee in her Hive!!!“ aus dem British Museum, das die Thronbesteigung Victorias von 1837 satirisch begleitet.

Diesem Potenzial spürt „Honiggelb“ in acht Kapiteln und anhand von 140 Münzen, Gemälden, Grafiken und Skulpturen nach. Eine Handvoll stammt aus dem Haus, darunter die fotografische Edition der „Honigpumpe am Arbeitsplatz“ (1977) von Joseph Beuys. Ein zweites Highlight ist Rebecca Horns immersive Installation „Bee’s Planetary Map“ (1998). Die Künstlerin hat sie vor ihrem Tod im vergangenen Jahr nach Wiesbaden gegeben, hier lockt das Werk am Ende der Schau in einen dunklen Raum, in dem aus 21 Strohkörben Licht auf bewegliche Spiegel am Boden fällt, während es überall summt – bis ein Stein zu Boden kracht und die vermeintliche Idylle jäh zerstört.
Die übrigen Werke sind Leihgaben aus teils prominenter Hand. Von Nicolas Poussin stammt das Bild „Jupiter als Kind mit Honig und Ziegenmilch genährt“ (um 1636), für dessen Motiv der Barockmaler auf eine griechische Überlieferung zurückgreift. Bei einem Doppelpokal aus vergoldetem Silber, der im 17. Jahrhundert in Nürnberg entstand, bilden die beiden Cuppae die Form eines Bienenstocks als Zeichen des durch Fleiß erarbeiteten Reichtums des Auftraggebers. Mit christlichen Votivgaben kommt ein weiteres Material in die Schau, das der Biene seit der Steinzeit abgerungen wird. Jene aus Wachs geformten Augen, Hände oder Fatschenkinder – in Bänder gewickelte Jesuskinder –, mit denen man im Mittelalter um Heilung von körperlichen Gebrechen bat, wurden professionell angefertigt und in die Kirchen gebracht. Weil Bienenwachs für absolute Reinheit stand, gelangten sie bis auf den Altar.

Aus dem Louvre stammt ein um 1550 entstandener Majolika-Teller mit dem seltenen Motiv eines brennenden Bienenstocks. Die Ausstellung deutet den abgebildeten Amor wie auch die Schlange als Symbol einer durch Eifersucht verwüsteten Beziehung. Die Leben spendenden Bienen müssen fliehen, die personifizierte Liebe nimmt Reißaus. Dem „langen 19. Jahrhundert“, in dem die Biene in Kunstwerken „als Kaisersymbol, Bürgeridyll und Schmuckelement“ erscheint, attestiert Andreas Henning ein sich veränderndes Verhältnis zu dem geflügelten Tier. Spätestens mit Hans Thomas Gemälde „Der Bienenfreund“ von 1863 wird es gefeiertes Gegenbild einer industriellen Entwicklung. Thoma kreiert einen Sehnsuchtsort, an dem Stille und Naturverbundenheit herrschen. Ein Gegenentwurf zur temporeichen Realität, in dem die Tiere mit ihrem sensiblen Betrachter zu kommunizieren scheinen.
Ihre Botschaften verbreiten sich ins 20. und 21. Jahrhundert, wo nahezu alle Künstlerinnen und Künstler auf die existenzielle Bedrohung der Biene und damit des Menschen hinweisen. Hier sitzt der schmerzhafte Stachel von heute.
Service
Ausstellung
„Honiggelb − Die Biene in der Kunst von der Renaissance bis in die Gegenwart“
bis 8. Februar 2026